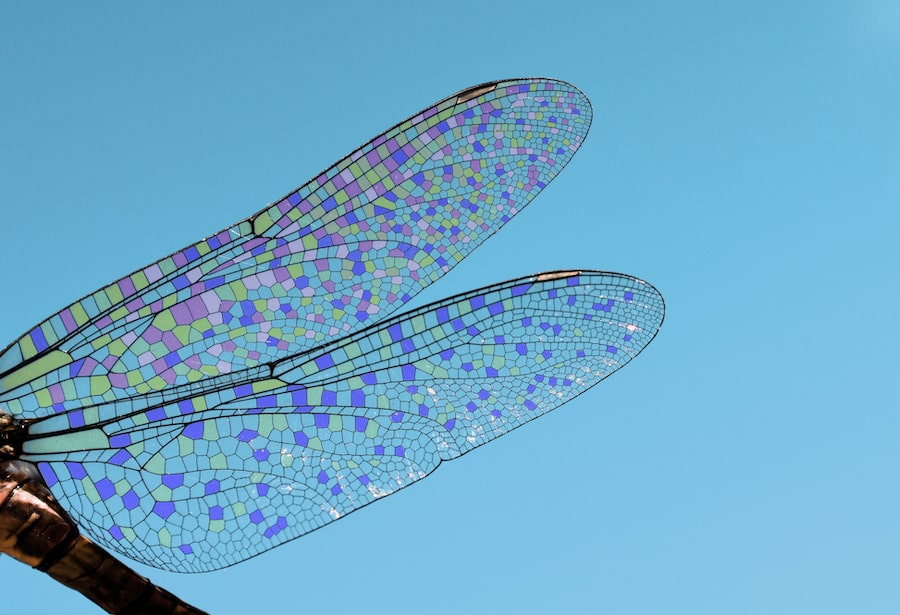„Überlasse dich sanft dem, was du wirklich liebst,
mit seinem seltsamen Sog.
Es wird dich nicht von deinem Weg abbringen.“
Rumi
Eine sinnlose Tätigkeit, kombiniert mit einer hohen Arbeitsmoral, ist das häufigste Anliegen meiner Klienten im Coaching. Sie fragen:
- Gibt es eine Tätigkeit, bei der man Erfüllung findet und die Rechnungen bezahlt?
- Wie hoch stehen meine Chancen, in meinem Job Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit und Erfüllung zu finden?
- Was mache ich mit meiner hohen Arbeitsmoral in einem Umfeld, in dem die Tätigkeit meinen inneren Werten nicht entspricht?
Mein erster ernsthafter Job war in Deutschland am Fließband Weihnachtsgeschirr einzupacken. Ich war neunzehn Jahre alt und musste mich ganz schön anstrengen. Nicht weil die Aufgabe mir schwerfiel, es fehlte mir an der nötigen Ernsthaftigkeit. Meine Chefin vermittelte mir den Eindruck, wenn man schon bei der Arbeit das Kreuz Jesus Christus nicht durch die Flure schleppe, dann solle man wenigstens den Eindruck erwecken, man trage eine ähnlich schwere Last. Sonst könnten die anderen auf die Idee kommen, die Arbeit wäre zu einfach, oder ich hätte zu wenig zu tun.
Die Deutschen werden im Iran für ihren Fleiß und ihre Disziplin sehr bewundert. Besonderes imponierend findet man die Leistung der Trümmerfrauen.
Was ich damals im Iran jedoch nicht wusste, war, dass alleine der Vermerk „Arbeitsscheu“ genügte, um in der Nazi-Zeit in die Konzentrationslager verschleppt zu werden. Ich wunderte mich nicht mehr darüber, wie fleißig die Menschen hier waren. Rasch verstand ich, welch hohen Stellenwert die Arbeit hier hatte, und, dass es normal war, wenn man dabei ernst und finster reinschaute.
Meine erste Auseinandersetzung mit dem Begriff Arbeit war jedoch im Iran. Es war während der iranischen Revolution. Ich war zwölf Jahre alt und erinnere mich ganz genau, wie zwei junge Studenten eine Wand mit dem Spruch „Wohnung, Brot und Arbeit für alle“ rot besprühten. Wohnung und Brot könnte ich sofort nachvollziehen, aber warum sollten alle Leute arbeiten?
Im Iran habe ich nie den Eindruck gehabt, dass Arbeit so einen hohen Stellenwert hatte, oder man dabei so eine finstere Miene machen musste. Man tat im Allgemeinen seine Arbeit mit mehr oder weniger Gewissenhaftigkeit. Aber das Leben drehte sich hauptsächlich um die Familientreffen, Ausflüge und nicht zuletzt in Ausübung der Religion. Bei meinem Vater, der als Lebensmittel-Importeur für einen großen Konzern tätig war, hatte ich nie den Eindruck, dass er arbeitete. Er war fast immer fröhlich, wenn er zur Arbeit ging. Wir waren als Kinder oft in den Ferienhäusern seines Chefs eingeladen. In den Sommerferien in seiner Villa am Kaspischen Meer, oder an Wochenenden in dem großen Garten in Karaj in der Nähe von Teheran. Sein Chef war, so etwas wie ein Opa für uns. Aus meiner Sicht war die Arbeit meines Vaters eher so, dass er sich immer mit neuen netten Ausländern anfreundete, um sie anschließend zum Ärger meiner Mutter zu uns nach Hause einzuladen.
Heute verstehe ich, warum die politisch eher linkseinzuordnenden Studenten der Arbeit damals dieselbe Gewichtung beimaßen, wie einer warmen Mahlzeit und einem Dach über dem Kopf.

Von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, ist es die Arbeit, die unsere Existenz sicherstellt. Und was man mit zwölf Jahren nicht wissen konnte, ist die enorme Rolle, die die Arbeit bei der Definition unserer Identität spielt. In der heutigen Gesellschaft ermöglicht Arbeit im großen Masse unsere sozialen Beziehungen, über die wir uns definieren und vergleichen.
Biologisch gesehen sind wir aufrecht gehende Säugetiere mit einer überproportionalen großen Hirnrinde. Ähnlich wie alle Säugetiere ist unser Wohlbefinden mit dem Gefühl der Gruppenzugehörigkeit und sozialen Anerkennung in der Gesellschaft fest verdrahtet. Mit zunehmender Industrialisierung erfüllten Menschen dieses Bedürfnisses immer mehr in dem Umfeld ihrer Erwerbstätigkeit, waren und weniger in ihren Familien.
Arbeitgeber insbesondere in Großkonzerne sind jedoch mit der Organisation der Arbeit und Entwicklung ihrer Mitarbeiter überfordert. Der Konkurrenzdruck unter Kollegen ist enorm, und es gibt wenige Arbeiten, die vom Belang sind.
Das menschliche Urbedürfnis nach Wirksamkeit und Anerkennung bleibt häufig auf der Strecke. Übrig bleibt nur der Lohn für eine Tätigkeit, der eher den Geschmack einer Entschädigungszahlung als eines Verdienstes hat.
Als 2013 David Graeber, Professor für Anthropologie an der London School of Economics and Political Science, dieses Thema in seinem Essay 400 Bullshit Jobs adressierte, löste er damit eine Lawine aus. Die Resonanz war überwältigend. Von überall auf der Welt erhielt er Zustimmung.
In seinem 2018 erschienen Buch beschreibt er ausführlich, welches seelische Leid die „Nonsens“-Beschäftigung verursacht:
„Zermürbend für den Bullshit-Jobber ist nicht allein der Frust darüber, auf welch nutzlose Art er die meisten wachen Stunden des Tages vergeudet, die elende Gewissheit, keine Ursache zu sein und keine Wirkung in der Welt zu haben, „eine direkte Attacke auf die Grundlage des Gefühls, dass man überhaupt ein Ich ist“.
David Graeber
Aber was ist die Lösung? Wie kann man seine Rechnungen bezahlen und dabei nicht nur ausbrennen, sondern zufrieden sein? Wie findet man in einer schnell sich wandelnden Arbeitsumfeld Tätigkeiten, die mit den eigenen Werten sich vereinbaren lassen? In wie weit kann ich mein Umfeld gestalten. Wann merke ich, dass ich gehen muss?
Der erste Schritt ist, aus dem Autopiloten rauszukommen und zu reflektieren, wie kann ich jeden Tag mehr von dem machen, was mich glücklich macht, meinem Leben einen Sinn gibt, und mir meine Wirksamkeit bewusst macht?
In seinem Buch “Accomplishing More by Doing Less” schreibt Marc Lesser, ehmaliger CEO des Search Inside Yourself Institute:
„Weniger zu tun führt zu mehr Liebe, mehr Effektivität und innerer Ruhe, und zu einer größeren Fähigkeit, mehr von dem zu erreichen, was für uns am Wichtigsten ist, und im erweiterten Sinne, für die Anderen und die Welt.“
Marc Lesser
Der nächste Schritt ist den eigenen Ikigai zu finden. Der Begriff „Ikigai“ kommt aus Japan und beschreibt den Grund des eigenen Lebens. Also das, wofür man morgens aufsteht. Ikigai ist die Schnittmenge aus vier verschiedenen Lebensbereichen. Wenn diese im Einklang sind, weiß man, wofür man auf dieser Welt ist – zumindest theoretisch.
Gemäß der japanischen Kultur hat jeder Ikigai. Es zeigt den Wert an, den man in seinem Leben findet, oder die Dinge, die jemandem das Gefühl geben, dass sein Leben wertvoll ist. Es bezieht sich sowohl auf geistige als auch auf spirituelle Umstände, die einem das Gefühl geben, dass sein Leben einen Grund hat.

Wirkt der Lebenssinn von Ikigai lebensverlängernd?
Dazu haben Toshimasa Sone und Mitarbeiter an der Universität in Sendai, Japan, ab 1994 eine siebenjährige Studie mit 43.391 erwachsenen Personen (Alter: 40 bis 79 Jahre) gemacht. Darin fragten Sie unter anderem auch nach dem jeweiligen Ikigai. Die Forscher umschrieben dabei den Begriff als „Glaube, dass es das eigene Leben wert ist, gelebt zu werden“. Mögliche Antworten waren ja, unsicher oder nein.
Fast 60 % der Studienteilnehmer hatten ja zum Empfinden von Ikigai gesagt und diese Personen waren zumeist verheiratet, hatten eine Ausbildung, und standen in einem Arbeitsverhältnis; sie gaben an, weniger Stress zu haben, und schätzten sich selber gesünder ein. Die Auswertung der Todesfälle ergab, dass Personen, die nein in Bezug auf Ikigai angegeben hatten, eine höhere Mortalität aufwiesen als diejenigen, die mit ja geantwortet hatten. Dass eine positive Lebenshaltung in Verbindung steht mit körperlicher Gesundheit und dadurch mit einer höheren Lebenserwartung, bestätigen auch andere Autoren. (Quelle: Wikipedia)
Autorin: Khatoun Shahrbabaki